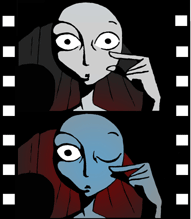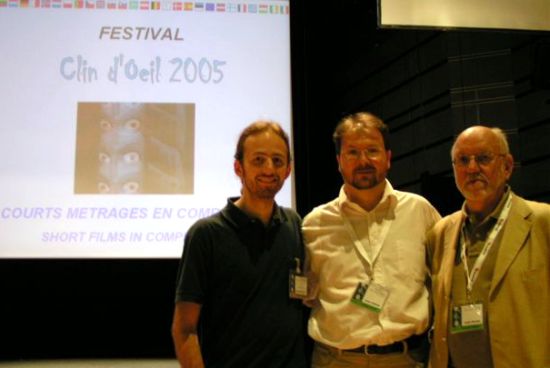|  Kulturfestival in Reims, Frankreich
Kulturfestival in Reims, Frankreich
Europäisches Kultur-Festival der Gehörlosen
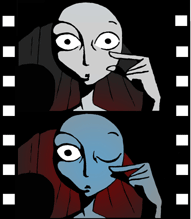
Vom 1. bis 3. Juli fand in der französischen Stadt Reims das
europäische Festival der Gehörlosenkultur „Clin
d’oeil 2005“ statt.
Davon berichten Ege Karar und Jochen Muhs
Das Festival „Clin d’oeil“ in Reims
ist ein europäisches Kulturfestival mit Film, Theater, Kunst
und vielem anderem. In meinem Bericht konzentriere ich mich besonders
auf den Bereich der Filme und erzähle ein wenig über das
Abendprogramm.
Alle gezeigten Filme wurden von Gehörlosen gemacht. Es wurden
insgesamt 19 Filme vorgeführt, von denen sieben ausgewählte
Beiträge an einem Wettbewerb teilgenommen haben. Die zwölf
anderen Filme, darunter auch zwei deutsche Filme, wurden bei dieser
Gelegenheit nur dem Publikum vorgeführt.
Die siebenköpfige Jury zur Beurteilung der Filme bestand aus
ziemlich berühmten Persönlichkeiten. Zur Jury gehörten
vier Gehörlose und drei Hörende.
Die gehörlose Juroren waren: Feliciano Sola Lima aus Spanien,
stellvertretender Präsident des Gehörlosen-Weltverbandes
und Vorsitzender des Gehörlosenverbandes in Galicien; Helga
Stevens aus Belgien, Präsidentin der Europäischen Gehörlosen-Verbandes
und Abgeordnete des flämischen Parlamentes; Emmanuelle Laborit,
Schauspielerin und Direktorin des Visuellen Theaters in Paris, sowie
Terry Riley aus England, der Produzent beim englischen Fernsehsender
BBC ist. Zu den hörenden Juroren, die meist aus dem Kino-Bereich
kamen, gehörte auch der Kulturassistent aus Reims.
Von zwei der insgesamt sieben Filmen, die am Wettbewerb teilgenommen
haben, gebe ich eine kurze Inhaltsbeschreibung. Mit dabei beim Wettbewerb
war beispielsweise auch ein Film vom einigen wahrscheinlich bekannten
Lars Otterstedt, der vor einiger Zeit im Kino in „Stille Liebe“
zu sehen war.
Von Con Mehlum aus Norwegen, der bereits zahlreiche
Filme vorgestellt und an einer Menge Festivals teilgenommen hat,
ist der Film „Café Lion“. Seine Filme sind unglaublich
professionell gemacht. Typisch für ihn sind eindrucksvolle
Bilder, tolle Effekte und ausdrucksstarke Metaphern. Im Film geht
es um folgende Geschichte:
Ein Mann arbeitet in einem Café hinter der Theke und zapft
Bier. Ein zweiter, alter und einsamer Mann sitzt in einer Kneipe
und beobachtet den Barkeeper, der gerade mit einer Bier- und Pizza-Bestellung
beschäftigt ist. Der Gast erkennt sofort, daß der Barmann
auch gehörlos ist und versucht, ihn in ein Gespräch zu
verwickeln. Er stellt ihm ständig Fragen über seine Arbeit,
seine Herkunft usw. Das nervt den Barmann schnell und er fühlt
sich beobachtet. In der rechten oberen Ecke des Bildes werden in
einer rußblauen Szene die Gedanken des Barmanns darstellt:
Der andere Gehörlose fragt ihn aus und er erzählt ständig.
Der Barmann überlegt, dass der Fragesteller wohl sehr einsam
sein muss. Dann schließt sich die Gedankenblase. Man sieht
wieder die tatsächliche Situation, in der der Barmann nur knappe
Antworten gibt. Daraufhin fragt der Gast den Barmann, ob er einsam
ist. Der Barmann antwortet nicht.
Dann verabschieden sie sich und der Gast verläßt das
Café. Wieder in einer rußblauen Gedankenblase sieht
man - diesmal aber als Gesamtbild - eine Katze und den Barmann,
die sich beide gegenübersitzen. Aus der Sicht der Katze wird
der Barmann gezeigt, wie er der Katze etwas erzählt ... - aus
Einsamkeit. Dieses Bild ist wirklich eine starke Metapher!
Als zweites möchte ich den Film des schwedischen
Regisseurs Jerome Cain vorstellen. In seinem Film “Alvet och
host“ spielt Alexej Svetlov mit. Der Film zeigt so ähnlich
wie beim ‚Daumenkino’ eine schnelle Bilderabfolge. Beispielsweise
sieht man einen Mann, der sich in aneinander gereihten Standbildern
im Raum bewegt. Das heißt, die Einzelaufnahmen wurden geschnitten
aneinander gehängt und ergeben so den Eindruck einer Bewegung.
Das Gleiche wird zum Beispiel mit einer Mütze gezeigt, die
sich in unterschiedlichen Positionen auf dem Kopf dreht, oder mit
einem Pinsel, bei dem die Bewegungen beim Malen in Einzelbildern
aneinander gereiht werden. Man kann sich denken, daß wirklich
eine Menge Arbeit dahintersteckt. Das Produkt ist eine tolle künstlerische
Darstellung.
Die Entscheidung der Jury hat überrascht: Der
schwedische Film “Alvet coch host“ mit den Daumenkinoeffekten
ergatterte den ersten Preis. Berühmte Filmproduzenten wie Con
Mehlum gingen leer aus. Mit dem 1.000 Euro-Preis möchte der
Sieger es ermöglichen, dass weitere Filme an Festivals teilnehmen
können.
Insgesamt gab es beim Festival qualitativ bessere und weniger lohnende
Beiträge zu sehen und es bleibt zu hoffen, daß auch in
Zukunft viele neue Filme entstehen.
Von den zwölf Filmen, die nicht am Wettbewerb teilgenommen
haben, stelle ich auch zwei vor. Der erste Film ist aus Italien
und handelt von einer Familie. Eine Frau lebt von ihrem Mann getrennt
mit ihrem Sohn und ihrem neuen Partner zusammen. Der Vater des Kindes
lebt alleine, fühlt sich sehr einsam und wünscht, wieder
zu seiner Familie zurückkehren zu können. Weil der Sohn
den neuen Partner seiner Mutter nicht akzeptiert, versucht er wegzulaufen.
Er rennt über die Straße und wird dabei beinahe von einem
Auto überfahren. Sein leiblicher Vater kann einen Unfall gerade
noch verhindern und rettet so seinen Sohn. Alle sind erleichtert
und die Mutter des Kindes entscheidet nach diesem Vorfall, wieder
zu ihrem Mann zurückzukehren, weil sie erkennt, wie wichtig
die Familie ist. Auch der geschiedene Mann wünscht sich, daß
die Familie zusammenhalten soll und wieder alle glücklich vereint
sind und sie für immer zusammen bleiben. Der Film will zeigen,
wie wichtig es ist, daß eine Familie für immer glücklich
zusammenhält.
Der zweite Film kommt aus Frankreich und spielt in
einem Gerichtssaal. Eine Dolmetscherin übersetzt die Verhandlung
für einen gehörlosen Angeklagten. Schließlich wird
er schuldig gesprochen. Die Dolmetscherin übersetzt den Urteilsspruch.
Daraufhin nimmt die Polizei die Dolmetscherin fest, die ihre Unschuld
beteuert und sagt, dass der Gehörlose der Schuldige ist. Doch
vergebens... Der Richter hat nicht begriffen, was die Aufgabe einer
Dolmetscherin ist und hält aus diesem Mißverständnis
heraus die Dolmetscherin für die Schuldige. Trotz heftiger
Gegenwehr wird die Dolmetscherin festgenommen und ins Gefängnis
gesteckt. Ein eher witziger Filmbeitrag auf dem Festival.
Nun noch ein paar Worte zum Abendprogramm, der „Deaf
Party“. Sie hat im Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Gehörlosen-Zentrum
stattgefunden. Das Haus ließ Emile Mercier erbauen, der durch
seinen Champagner weltberühmt geworden ist. Es ist das erste
Gehörlosen-Zentrum Europas. Wirklich bemerkenswert für
die Stadt Reims! Die Abendveranstaltung von „Clin d’oeil“
fand unter anderem in diesem älteren, mittelgroßem Haus
statt, weil sich dort ein Denkmal von Abbé de l’Epée
befindet, der Persönlichkeit, an die sich viele Gehörlose
immer wieder erinnern. Das Abendprogramm wurde von Gruppen aus Lettland,
Spanien und aus Frankreich gestaltet. Die Mitglieder der lettischen
Tanzgruppe waren alle unter 18 Jahre alt, also noch minderjährig
und haben verschiedene schöne Tänze präsentiert.
Toll, daß sie trotz ihres Jugend schon den Mut hatten, ihr
Programm zu zeigen.
Die französische Truppe zeigte eine Mischung aus Trommeln und
Tanz-Vorführungen. Einer der Trommler hat es auf sehr geschickte
Art und Weise geschafft, mit Trommeln und einer Art Gebärdenliedern
den Kontakt zum Publikum herzustellen. Er hat die Trommel-Gruppe
und das Publikum so eingebunden, daß alle zusammen gefeiert
haben und nicht nur eine ‚einseitige’ Show entstanden
ist. Auf diese Art kam ein Dialog zwischen der Gruppe und den Zuschauern
zustande und diese ‚Unterhaltung’ hat sehr viel Spaß
gemacht. Der Raum war ziemlich überfüllt, wo die Vorführungen
stattgefunden haben.
Außerdem gab es im Hof hinter dem Gehörlosen-Zentrum
die Gelegenheit, sich in gemütlicher Atmosphäre zu unterhalten
und auszutauschen bis gegen zwei oder drei Uhr am Morgen die Türen
geschlossen wurden.
Ege Karar

Gruppenfoto der deutschen Besuchern in Reims
Ein Festival für Kunstfreunde
Über eine Rolltreppe kamen die Gäste in die lichtüberflutete
Kongresshalle zum Kulturfestival. 39 gehörlose Künstler
und Künstlerinnen aus neun Ländern repräsentierten
hier ihre Gemälde und Fotografien, ihr Kunsthandwerk und anderes.
Deutschland war mit 13 Teilnehmern zahlreich vertreten. Elf Künstler
kamen aus Frankreich, vier aus Italien, drei aus Österreich,
zwei aus England, einer aus der Schweiz und einige aus Belgien.
Dieter Fricke stellte seine farbenfrohen Bilder mit den typischen,
die Gebärdensprache symbolisierenden Strichen aus. Mit Zuversicht
sprach er über sein erfolgreiches Engagement für die Gebärdensprache
an Schulen für Hörende. Die Brüder Mertz fehlten
nicht. Der Allroundkünstler MM (Manfred Mertz) demonstrierte
in den Theaterpausen auf dem runden Tisch seine surrealistischen
Bilder. Rudolf Werner erklärte unermüdlich seine Kunstwerke,
darunter die bekannte Schaufensterpuppe mit den drei Punkten der
Behinderten.
Die schönen Sport- und Landschaftsfotografien vom Oliver Bardt
aus Bremen zeigen vom Können des jungen Fotografen aus Bremen.
Gleiches gilt für den in Paris wohnenden Jean Philippe, der
künstlerische Schwarz-weiß-Bilder ausstellte. Auffällig
waren die Illustrationen und Comic-Zeichnungen von Künstlern
aus Frankreich und der Schweiz. Die starken Comic-Bilder sind klar
gezeichnet. Ob die Künstler allerdings von dem Verkauf ihrer
Zeichnungen leben können, ist für mich fraglich. Die ideenreiche
Firma „Conte Sur Tes Doigts“ aus Lille verkaufte lebendig
gehaltene Vorlese- und Lehrbücher mit originellen Bildern und
DVDs in Gebärdensprache für Kinder und Eltern.
Ich wurde Besitzer eines Kunstwerks des italienischen Künstlers
G. Bergamaschi. Auf Zeitungen, Briefe usw. macht er mit dicken Strichen.
Mit diesen Kunstwerken protestiert er gegen Politiker und Journalisten.
Seine Kunst fand aber bei den gehörlosen Besuchern wenig Beachtung.
Bergamaschi besuchte die Akademie der schönen Künste “Brera”
zu Mailand. Im September hat er seine Kunstwerke in einer Galerie
in Rochester (USA) ausgestellt.
Die weichen und lebendigen Zeichnungen und chinesische Pinselschrift
von Hua Shan Bähr zogen die Gäste in den Bann. Die grünen
Bücher mit hübschen Zeichnungen der jungen Illustrations-Designerin
Barbara Schuster aus Wien nötigten mir einen gewissen Respekt
ab. Lukas Kollien, der kürzlich im Hamburger Gehörlosenzentrum
die Hummel-Figur errichtete, zeigte Skulpturen und Karikaturen.
Viele Bilder kamen mir bekannt vor. Ich habe Mut, Engagement und
Phantasie vermisst.
In der Ausstellung waren akademische Berufskünstler, die tatsächlich
ihren Lebensunterhalt mit Kunst verdienen, nicht auszumachen. Es
wäre ratsam und begrüßenswert, eine europäische
Künstlervereinigung für gehörlose akademische Kunstmaler,
Bildhauer und Kunsthandwerker zu gründen. Ihre Werke sollten
in Kunstausstellungen bevorzugt werden.
Die Kunsthandwerkerin Sandrine Basset aus Frankreich zeigte Glasbilder
mit farbenfrohen und klaren Kontrasten. Sie verkaufte auch schönen
Glasschmuck. Mit ihren Schmuckstücken bewies Julia Klunker
aus Hanau, schwerhörige Meisterschülerin für Schmuckgestaltung,
viel Talent. Mit zahlreichen Blumen demonstrierte ein Florist aus
Belgien die Kunst der Blumenbinderei. Der Schneider Brusselman aus
Belgien zeigte sein Können im alten Handwerksberuf.
Die Kunstausstellung in der schönen Halle regte
die Theaterbesucher in den Pausen zum Nachdenken an und sorgte für
Entspannung. Zahlreiche Kunstwerke zeigten mit ihrer visuellen Bildersprache
das besondere Können der gehörlosen Künstler. Sie
sind oft farbenfroher und kontrastreicher als die der hörenden
Künstler...
Viele Besucher scheuten den Kauf. Schön wäre es, wenn
sie ihre Wohnung und die Klubheime mit den Werken gehörloser
Künstler schmücken würden. Ich habe ein Gemälde
des verstorbenen Malers Albert Fischer – Fisé - vom
Ammersee, worauf ich stolz bin.
Nach den Kulturtagen besuchte ich den Bildhauer Malaussena, der
bei Paris wohnt. Er war nicht nach Reims gekommen, weil er bisher
seine Kunst nicht gut verkaufen konnte. Malaussena ist durch „die
drei Grazien“ im Berliner Gehörlosenzentrum bekannt.
Vom ihm erwarb ich eine Skulptur. Am nächsten Tag besuchten
wir beide das Haus am See in Giverny des weltbekannten hörenden
Malers Claude Monet. Die zahlreichen Besucher meiner Führungen
bei der MOMA 2004 in Berlin erinnern sich sicher an das etwa 13
m lange Gemälde mit den Seerosen.
Trotz meiner Kritik halte ich die Kunstausstellung in Reims für
gelungen. Umso mehr bedauere ich wie andere Freunde der Kultur und
Kunst den Ausfall der deutschen Kulturtage 2006 in Köln.
Jochen Muhs

Fotos
von Helmut Vogel

Alexej Svetlov und Jerome Cain, Gewinner des
Filmpreis

ChanDanse des Sourds beim Abendprogramm

Die Künstlerin Hua Shan-Bähr

Manfred Mertz in Aktion...

Rudolf Werner erklärt sein Kunstwerk...
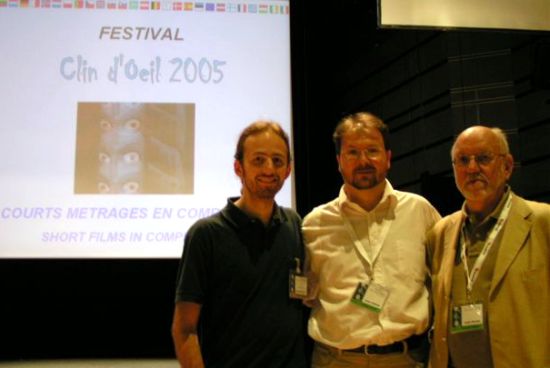
Ege Karar, Helmut Vogel und Jochen Muhs beim Festival

|